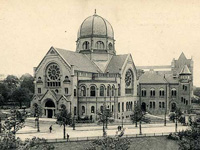
Die Aufteilung der jüdischen Dreigemeinde in Hamburg 1812von Simon Hollendung
|
4.2 Die erste Besetzung Hamburgs zur Durchsetzung der Kontinentalsperre und ihre Folgen
Nach dem Sieg über Preußen erfolgte am 19. November 1806 die Besetzung Hamburgs durch französische Truppen.[110]
Zur Durchsetzung der Kontinentalsperre war Hamburg strategisch wichtig und deshalb wurde nach der Besetzung ein generelles Handelsverbot mit England erlassen. Alle englischen Waren und Schiffe (auch anderer Länder, wenn sie englische Waren führten) wurden beschlagnahmt und englische Staatsbürger als Kriegsgefangene festgesetzt.
Der Handel war stark beeinträchtigt, Bestechung und Schmuggel ins dänische Altona blühten umso mehr. Hinzu kamen Zwangsrekrutierungen der französischen Armee infolge der Vorbereitung zum erneuten Feldzug gegen Österreich ab 1809.
Ab Juli 1811 wurde Hamburg mit dem französischen Kaiserreich vereinigt und Ort der kaiserlichen Gerichtsbarkeit. Wie Amsterdam, Rotterdam, Bremen und Lübeck gehörte Hamburg zu den bonnes villes, den Städten ersten Ranges. Ihre Maires (Bürgermeister) hatten das Recht, den großen kaiserlichen Festen in Paris (Thronbesteigung, Eidesleistung, Taufe usw.) beizuwohnen.[111]
Am 20. August 1811 trat die französische Gesetzgebung in Kraft, es kam zur politischen Gleichstellung aller Einwohner und allgemeinem Wahlrecht wie es die Prinzipien der Französischen Revolution vorsahen. Für die Juden Hamburgs war diese Gleichstellung aber nur theoretischer Natur, da es Ausnahmedekrete für sie gab (Vgl. Kap. 5). Die Zünfte und das Feudalwesen wurden abgeschafft, was Betätigungsfreiheit verhieß. Strafprozesse wurden öffentlich verhandelt, mit klarem Strafmaß anhand eines Strafgesetzbuches. Die Gerichtsverfahren wurden beschleunigt, allen voran durch die Trennung von Regierung und Justiz per Einführung des kaiserlichen Gerichtshofes.
Gleichzeitig verschlechterte sich die Situation der Hamburger Bürger aber erheblich. Die Franzosen gingen schärfer gegen den Schmuggel vor und nahmen daher vielen Familien ihre Lebensgrundlage. Zusammen mit dem Gerücht, dass russische Verbände bereits kurz vor der Stadt stünden, entlud sich der Konflikt am Millerntor, der Zollgrenze nach Altona, im Volksaufstand vom 24. Februar 1813. Trotz harter Vergeltungsmaßnahmen und Hinrichtungen einiger Aufständischer widersetzten sich mehr und mehr Hamburger den Befehlen und Auflagen der französischen Beamten.[112]
[111] Vgl. Stieve (1998), S. 108ff.
[112] Vgl. Zunker (1983), S. 60ff.
Inhalt
- 1 Juden in Hamburg
- 2 Die Geschichte der Sepharden im Hamburger Raum
- 2.2 Juden aus Hamburg ziehen in die neuen Kolonien und bauen Handelswege auf
- 2.3 Neue Reglements machen das kleine Städtchen Altona für die Sepharden attraktiv
- 2.4 Sabbatianismus und weitere innerjüdische Probleme der sephardischen Gemeinde
- 2.5 Die Bedeutung der Sepharden für die Untersuchungsfrage
- 3 Die Geschichte der Aschkenasim im Hamburger Raum
- Die frühesten Ansiedlungen von Aschkenasim im Hamburger Raum sind durch die Quellen nicht belegt
- 3.1.1 Erste belegte Ansiedlung in Altona und der Zuzug weiterer Juden aufgrund großzügiger Privilegien
- 3.1.2 Die kleine jüdische Gemeinde in Harburg
- 3.1.3 Wandsbek als erster Ort der jüdischen Ansiedlung mit rasantem Abstieg
- 3.1.4 Der Grund aller Ansiedlungen im Hamburg Raum: Die Freie- und Hansestadt Hamburg
- 3.2 Der Altonaer Friedhofstreit führt zur Gründung der Dreigemeinde
- 3.3 Der Hamburger Amulettenstreit und seine beiden Protagonisten Jonathan Eybenschütz und Jakob Emden
- 3.4 Die letzte Phase der Dreigemeinde und ein kurzer biografischer Abriss der letzten Oberrabbiner
- 4 Hamburg in der Franzosenzeit (1806-1814)
- 4.1 Frankreich seit dem Staatsstreich Napoleons und Hamburgs Wirtschaftsboom zu dieser Zeit
- 4.2 Die erste Besetzung Hamburgs zur Durchsetzung der Kontinentalsperre und ihre Folgen
- 4.3 Das Zwischenspiel der Befreiung
- 4.4 Frankreichs Niederlage, der Rückzug in die Stadt und die sich anschließende Belagerung sorgen für Elend bei der Bevölkerung
- 4.5 Die Befreiung Hamburgs
- 4.6 Welche Auswirkungen hatte die Franzosenzeit für die Juden?
- 5 Napoleons Judengesetzgebung
- 5.1 Der jüdische Kampf um das Bürgerrecht und die Assimilationsbestrebungen der Haskalah
- 5.2 Die Judenfrage wird zur Staatsangelegenheit
- 5.3.1 Die Einberufung einer jüdischen Notabelnversammlung
- 5.3.2 Die Auswahl der Notabeln
- 5.3.3 Die Notabelnversammlung
- 5.4 Vorbereitungen zum Sanhedrin
- 5.5 Das Sanhedrin
- 5.6 Vom Abschluss der Versammlungen bis zu den Kaiserlichen Dekreten Napoleons vom 17. März 1808
- 5.7 Die Wirkung der Dekrete für die Juden in Frankreich
- 6 Die Aufteilung der Dreigemeinde
- 7 Untersuchungsergebnis
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Links