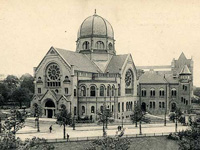
Die Aufteilung der jüdischen Dreigemeinde in Hamburg 1812von Simon Hollendung
|
5.3.3 Die Notabelnversammlung
Die jüdischen Deputierten kamen bereits am 15. Juli 1806 in Ungewissheit über das, was sie erwartete, nach Paris.
Am 26. Juli hatte der Innenminister ins Hotel des Ville (Rathaus) eingeladen. Die Tagesordnungspunkte waren die Wahl eines Präsidenten und zweier Sekretäre sowie drei Beisitzer, die alle zusammen das Präsidium der Notabelnversammlung stellten.
Der Innenminister sagte, dass dem Präsidium dann die 12 Fragen der Kaiserlichen Kommission mitgeteilt würden. Grund der Fragen sei es, „die Juden zu nützlichen Bürgern zu machen, ihren Glauben mit den Pflichten der Franzosen in Übereinstimmung zu bringen, die Vorwürfe, die man ihnen macht, abzuwenden und den Übeln abzuhelfen, die sie verursacht haben.“[151]
Als erstes mussten die Notabeln über die Festlegung des ersten Sitzungstages beraten. Dieser war, wohl auch um die Gesinnung der Juden zu prüfen, auf einen Schabbath gelegt worden. Einige Rabbis empörten sich darüber, doch man wollte nicht schon vor Beginn der Versammlung Zwietracht säen und somit wurde der Schabbath als Sitzungstag angenommen. Kleinere Störfeuer und Versuche aus einigen Departements, die Versammlung zu verzögern, wurden ebenfalls im Keim erstickt. Die Wahl des Präsidiums ergab Furtado als Präsidenten; Isaac Samuel Avigdor und Rodrigues als Sekretäre; Olry Hayem Worms, Theodor Cerfberr und Emil Vitta als Beisitzer.
Furtado war schon lange für die Integration der jüdischen Religion ins französische Staatsgefüge eingetreten (s.o.) und somit hatte seine Wahl auch einen symbolischen Charakter.
Im Vergleich zur Hamburger Situation war aber auch bedeutend, dass Furtado Sepharde war. Nach van der Walde zeigte die Wahl, „dass die Unterschiede, die man den portugiesischen und deutschen Juden anhaften wollte, nur persönlicher Natur waren. Die Juden des Südens [Frankreichs] weigerten sich, ihre Interessen mit denen des Nordens zu verschmelzen, obwohl sie doch alle Kaufleute oder Industrielle wie diese waren, nur mit dem Unterschied, dass die des Südens in Reichtum, während die des Nordens größtenteils in Armut lebten.“[152]
In der ersten Rede versuchte Lippmann Cerfberr, alle etwaigen Differenzen zu zerstreuen und ein Einheitsgefühl herzustellen: „Vergessen wir, woher wir stammen! Nichts mehr von Elsässer Juden, nichts mehr von Portugiesen, nichts mehr von deutschen Juden. Über den Erdboden zerstreut, sind wir doch nur ein einziges Volk, denselben Gott anbetend, und wie unser Gebot es befiehlt, der Macht unterworfen, unter deren Gesetze wir leben.“[153]
Am zweiten Versammlungstag, dem 29. Juli, wurden die zwölf zu beantwortenden Fragen vorgelesen (siehe Anhang B). Molé, Portalis und Plasquier waren per kaiserlichem Dekret zu Bevollmächtigten ernannt worden und ersterer wurde, weil seine Meinung über die Juden bekannt war, von selbigen gehasst.[154] Plasquier und Porrtalis mussten ihn in seinem Judenhass und seinem aufbrausenden Temperament mehrmals zügeln.
Molé hielt eine Rede und sprach im Tonfall einer Drohung davon, dass die Juden mit der Regierung zusammenarbeiten sollten, um ihren Eintritt in die französische Nation zu verwirklichen. Anschließend werden die 12 Fragen vorgelesen.
Furtado antwortete sehr geschickt auf Molés Drohungen und schaffte es auch, Napoleons Missgunst in Vertrauen umzuwandeln. Anschließend wurde eine Kommission aus den Deputierten gewählt, die die Beantwortung der Fragen vorbereiten sollte.
Nach Grätz war es schließlich hauptsächlich die Arbeit von Rabbi David Sinzheim, der innerhalb von nur sechs Tagen die Beantwortung ausgewogen und befriedigend für alle Beteiligten ausarbeitete.[155]
Eine bemerkenswerte Rede hielt auf dieser zweiten Versammlung Isaac Berr. Er erinnerte die Juden an ihre Geschichte der Unterdrückung und das das jüdische Volk – obwohl zerstreut über den ganzen Erdball – nicht untergegangen wäre und darin die Zuversicht läge, dass es nicht untergehen werde. Berr sprach vom Licht der Wissenschaft und vom heiligen Feuer. „Lasst uns schwören, beides zu bleiben: Franzosen, indem wir mit Eifer das von uns geliebte Vaterland verteidigen, und Juden, indem wir den religiösen Gesetzen und dem Glauben unserer Väter treu bleiben. Als beides wollen wir unserem erhabenen Kaiser und König ewige Liebe schören.“[156]
Die Verbindung von mosaischen Gesetz und Vaterlandsliebe in der Rede Berrs haben viele Aufklärer in Deutschland auch beschworen. Viele aufgeklärte Hamburger Juden hätten den Fragenkatalog wohl ähnlich der Notabeln-versammlung beantwortet und einen Ausgleich zwischen Staat und Religion gesucht.
Für das Altonaer Rabbinat war eben diese Verbindung nicht möglich und vor allem an den Fragen der Funktion des Rabbiners und seiner polizeilichen Gewalt (= Banngewalt), also den alten Hamburger Streitpunkten, hatte sich gezeigt, dass das konservative (chassidistische) Oberrabinat noch nicht in der moderne angekommen war, obwohl die wichtigen Fragen im Hamburger Raum auch in der französischen Notabelversammlung zur Sprache kamen.
[152] Ebd., S. 38.
[153] In: Bran (1807/1808), S. 185.
[154] Vgl. Van der Walde (1933), S. 38.
[155] Grätz (1900), S. 286.
[156] In: Bran (1806/1807), S. 185.
Inhalt
- 1 Juden in Hamburg
- 2 Die Geschichte der Sepharden im Hamburger Raum
- 2.2 Juden aus Hamburg ziehen in die neuen Kolonien und bauen Handelswege auf
- 2.3 Neue Reglements machen das kleine Städtchen Altona für die Sepharden attraktiv
- 2.4 Sabbatianismus und weitere innerjüdische Probleme der sephardischen Gemeinde
- 2.5 Die Bedeutung der Sepharden für die Untersuchungsfrage
- 3 Die Geschichte der Aschkenasim im Hamburger Raum
- Die frühesten Ansiedlungen von Aschkenasim im Hamburger Raum sind durch die Quellen nicht belegt
- 3.1.1 Erste belegte Ansiedlung in Altona und der Zuzug weiterer Juden aufgrund großzügiger Privilegien
- 3.1.2 Die kleine jüdische Gemeinde in Harburg
- 3.1.3 Wandsbek als erster Ort der jüdischen Ansiedlung mit rasantem Abstieg
- 3.1.4 Der Grund aller Ansiedlungen im Hamburg Raum: Die Freie- und Hansestadt Hamburg
- 3.2 Der Altonaer Friedhofstreit führt zur Gründung der Dreigemeinde
- 3.3 Der Hamburger Amulettenstreit und seine beiden Protagonisten Jonathan Eybenschütz und Jakob Emden
- 3.4 Die letzte Phase der Dreigemeinde und ein kurzer biografischer Abriss der letzten Oberrabbiner
- 4 Hamburg in der Franzosenzeit (1806-1814)
- 4.1 Frankreich seit dem Staatsstreich Napoleons und Hamburgs Wirtschaftsboom zu dieser Zeit
- 4.2 Die erste Besetzung Hamburgs zur Durchsetzung der Kontinentalsperre und ihre Folgen
- 4.3 Das Zwischenspiel der Befreiung
- 4.4 Frankreichs Niederlage, der Rückzug in die Stadt und die sich anschließende Belagerung sorgen für Elend bei der Bevölkerung
- 4.5 Die Befreiung Hamburgs
- 4.6 Welche Auswirkungen hatte die Franzosenzeit für die Juden?
- 5 Napoleons Judengesetzgebung
- 5.1 Der jüdische Kampf um das Bürgerrecht und die Assimilationsbestrebungen der Haskalah
- 5.2 Die Judenfrage wird zur Staatsangelegenheit
- 5.3.1 Die Einberufung einer jüdischen Notabelnversammlung
- 5.3.2 Die Auswahl der Notabeln
- 5.3.3 Die Notabelnversammlung
- 5.4 Vorbereitungen zum Sanhedrin
- 5.5 Das Sanhedrin
- 5.6 Vom Abschluss der Versammlungen bis zu den Kaiserlichen Dekreten Napoleons vom 17. März 1808
- 5.7 Die Wirkung der Dekrete für die Juden in Frankreich
- 6 Die Aufteilung der Dreigemeinde
- 7 Untersuchungsergebnis
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Links