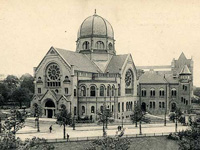
Die Aufteilung der jüdischen Dreigemeinde in Hamburg 1812von Simon Hollendung
|
5.2 Die Judenfrage wird zur Staatsangelegenheit
Aus Austerlitz kommend befand sich Napoleon am 23. und 24. Januar 1806 in Straßburg. Obwohl es keine Quellen darüber gab, müssen dem Kaiser hier die aktuellen Gerüchte und Klagen über die Juden im Elsass zu Ohren gekommen sein.
In dieser Region Frankreichs scheint der Judenhass besonders tief gewesen zu sein : „Man sagte, dass sie in alle kaufmännischen Berufe eingedrungen wären und durch ihre Wuchergeschäfte fast alles Eigentum in ihre Hände gebracht hätten. Man spräche im Lande davon, die Juden zu ermorden.“[131]
Allerdings standen sich auch hier aufgeklärte und konservative Meinungen gegenüber. So wird, eventuell sogar Napoleon direkt, ein Vorfall berichtet, bei dem ein Stadtrat auch die ortsansässigen Juden zur Ehrengarde eingeladen hätte, weshalb andere Teilnehmer empört ihre Teilnahme absagten.
Spätestens seit April 1805 war es Napoleons Ziel, den „jüdischen Wucher“ zu unterdrücken. Eindeutig ist nach van der Walde, dass sein Aufenthalt in Straßburg die Judenfrage beschleunigte.[132]
Bereits zuvor hatte der Justizminister die Juden in einem Bericht denunziert und dafür aus Fällen des Straßburger Handelsgerichtes zitiert, ohne diese zu überprüfen. Hinzu kamen ähnliche Beschwerden über angeblichen jüdischen Wucher aus anderen Teilen des französischen Kaiserreiches. Der Kaiser wurde daher gebeten, gegen dieses Übel geeignete Mittel zu ergreifen. Mit dem Übel war allerdings der Wucher allgemein gemeint, also nicht ausschließlich gegen die Juden.[133]
Der Stadtrat von Strassburg hielt sich allerdings an die Vorgaben im Code Civil und verfasst keine gesetzliche Begrenzung für Zinssätze.
Der Justizminister veröffentlichte daraufhin einen zweiten, wesentlich schärferen Bericht, wiederum gespickt mit Einzelfällen des Handelsgerichtes. Dieser Bericht wendete sich direkt gegen die Juden und verlangte als Maßnahmen, dass Geldgeschäfte nur noch im Beisein nicht-jüdischer Zeugen (die haftbar zu machen wären) und unter öffentlicher Zählung der Beträge stattfinden durften. Dies seien „Vorsichtsmaßnahmen gegen die Juden […], die aus Polen und Deutschland während der Revolution eingewandert seien und das Land jetzt überschwemmten.“[134]
Napoleon, die Ideen von Innen- und Justizminister aufnehmend, formulierte noch schärfere Forderungen: Alle Hypothekenverträge, die schon von Juden abgeschlossen worden waren, sollten rückgängig gemacht und allen Bürgern, die am 1. Januar 1807 besitzlos, also ohne Eigentum, wären, sollte das Bürgerrecht entzogen werden.
Vor allem die letzte Bestimmung zeigt, wie schnell die Errungenschaften der Französischen Revolution im kaiserlichen Frankreich wieder abgeschafft wurden. Gleichberechtigung war nach dem Code Civil und vor allem den folgenden Sonderbestimmungen fast nur noch eine theoretische Größe geblieben.
Es war wohl die nicht erhaltene Position des Innenministers, der sich deutlich gegen die „Machenschaften im Elsaß“[135] wendete. Er hob hervor, dass die Juden durch die Revolution in eine durchaus bessere wirtschaftliche Lage versetzt worden seien. Im Gegenteil hätten sie aber die Hoffnungen, die von Regierung in sie gesetzt wurden, nicht erfüllt.
Die Berichte der beiden Minister wurden dem Staatsrat übergeben und dort sollte sich Regnault de Saint-Jean-d´Angely, der Präsident der Sektion des Inneren, mit ihnen befassen. Regnault war den Juden freundlich gesonnen, er hatte im Juli 1790 verhindert, dass den Juden von Metz gemachte Zugeständnisse wieder rückgängig gemacht wurden und vor allem als Präsident der Nationalversammlung mit dafür gesorgt, dass den Juden die Bürgerrechte verliehen wurden.
Dieser Regnault übergab die Behandlung der Judenfrage an Molé, „einen konservativen Staatsmann, der Napoleon ganz ergeben und vom Hass gegen die Juden beseelt war.“[136] Diese Wendung mag verwundern, gründete aber wohl auf einen Wunsch Napoleons, den ihm nahe stehenden Molé mit diesen Dingen zu befassen.
Die Beratungen fanden zunächst nur in der Sektion des Inneren und dann im gesamten Staatsrat statt. Dabei formierte sich Beugnot als gemäßigter Gegenspielers Molés.
Beugnot schilderte in seinem Bericht zunächst den Zustand, der durch den Wucher der Juden im Elsaß entstanden sei, und schlug dann Gesetze vor, die nach seiner Meinung zu einer Besserung der Lage führen könnten. Er wies daraufhin, „dass in gewissen Teilen Frankreichs die Juden Schlüsselstellungen im Handel einnehmen, und, wenn man ihnen das Bürgerrecht nehme, sie gewiss ihre Kapitalien ausführen würden, was für Frankreich eine starke Benachteiligung bedeute.“[137]
Ähnlich wie seit ehedem der Hamburger Senat, so argumentierte hier auch Beugnot für Frankreich mit dem wirtschaftlichen Vorteil. Anders als in Hamburg durfte es nach der Revolution und den Bürgerrechten in Frankreich aber keine Sondergesetze gegen Teile der Bevölkerung geben. Die Sektion Inneres stimmte gemäß Beugnot diesem Rechtsgrundsatz zu, sah aber im Elsass Ausnahmefälle, die eine rechtliche Regelung erforderlich machten.
„Der Eindruck dieses Berichtes war groß“[138], berichtet van der Walde und bezeichnenderweise schwieg Molé zu den sich abzeichnenden Wendungen. Napoleon zeigt sich an den Berichten und Beratungen sehr interessiert, aber anderer Meinung. Deswegen wurden die Sitzungen zunächst verschoben, bis am 30. April 1806 der Kaiser selbst anwesend war und den Vorsitz des Staatsrats ausübte.
Die Sitzung begann mit einem Bericht Beugnots, der gegen die Meinung von Kaiser und Innenminister die Auffassung vertrat, dass die Polizei gegen den Wucher vorgehen sollte. Danach steigerte er sich in freier Rede zu unüberlegten Äußerungen über die Unterdrückung des jüdischen Volkes.
Napoleon reagierte gereizt und hielt eine hasserfüllte Rede voller Stereotype, die den Berichten Bonalds und Molé entnommen schienen, gegen die Juden. Sein Standpunkt, der in der Rede zum Ausdruck kam, ist folgender: „Die Revolution hat den Juden die Gleichberechtigung nur gegeben, weil sie sie als Glaubens-gemeinschaft oder Sekte betrachtete. Da es sich aber ergeben hat, dass die Juden eine Nation bildeten, müssen sie auch anders behandelt werden als die übrigen Franzosen.“[139]
Erwartungsgemäß stellt Molé daraufhin seinen Bericht an die Seite Napoleons und Regnault ergrief für Beugnot Partei. Napoleons Äußerungen waren laut van der Walde aus Zorn über Beugnots Worte gefallen und stellten nur bedingt seine wirkliche Meinung da.[140]
Es wird eine Kaiserliche Kommission eingesetzt, bestehend aus Molé, Portalis und Plasquier, um die Dinge sachlich zu klären. Napoleons Rede auf der zweiten Staatsratsitzung am 7. Mai stellt einen Sinneswandel dar.
„Zwar steht der Kaiser noch immer auf dem Standpunkt, dass die Juden in Bezug auf den Handel Ausnahmegesetzen unterworfen werden müssten. Er kommt [aber] zu der Anschauung, dass die Juden gebessert werden müssten. Dies könne nach seiner Meinung nur dadurch geschehen, dass man eine Versammlung der jüdischen Notabeln[141] einberufe und diese zwinge, das mosaische Gesetz in Harmonie mit den Staatsgesetzen zu bringen.“[142]
Diese differenzierte Meinung Napoleons beruhte wohl auch auf einer Unterredung mit Molé. Nachdem der Kaiser sich beruhigt hatte, wurde ihm klar, dass in der hasserfüllten Meinung Molés keine Zukunft für ein Zusammenleben zwischen Juden und Nicht-Juden liegen würde.
Napoleon wollte die Juden bessern statt sie mit Maßnahmen zu versehen. Diese Haltung war auch im Deutschen Reich zur damaligen Zeit als eher aufgeklärt bekannt, weil sie voraussetzte, dass man die Juden bessern konnte. Demgegenüber standen konservative Kreise mit ihrem Bild von Ahasver[143], dem ewig bösen Juden und Jesusmörder. Solche Ansichten kamen in Hamburg häufig von den Kanzeln der christlichen Kirchen (Vg. Kap. 3.1.4).
[132] Ebd, S. 25.
[133] Vgl. ebd, S. 24f.
[134] Vgl. Van der Walde (1933), S. 26.
[135] Vgl. ebd, S. 27.
[136] Ebd, S. 28.
[137] Ebd..
[138] Ebd, S. 29.
[139] Vgl. Van der Walde (1933), S. 30.
[140] Vgl. Ebd, S. 31.
[141] Notabeln (frz. notables) waren die Angehörigen der sozialen Oberschicht, deren Ansehen auf einem hohen Rang, besonderen Verdiensten oder einem großen Vermögen beruhten. Sie waren am politischen Prozess des Staates beteiligt. Der Begriff des Notabeln ist nicht deckungsgleich mit dem des Großbürgers, der Personen bürgerlicher Herkunft mit großem Vermögen und entsprechendem Lebensstil meinte, während Notabeln in Abgrenzung hierzu auch jene Personen erfassen, die auch ohne großes Vermögen aufgrund ihres Ansehens und Ranges eine gesellschaftlich herausgehobene Stellung innehatten.
[142] Van der Walde (1933), S. 32.
[143] Ahasver (hebr.: Fürst; lateinisierte Form: Ahasverius), der ewige Jude, der nach der Legende nicht mehr ruhen darf, weil er Christus geschlagen, oder, je nach Version, eine Rast verweigert hat. Der ewig ruhelose Ahasver war oft Ausgangspunkt für theologisch motivierten bzw. intellektuellen Judenhass und ist Motiv vieler Romane.
Inhalt
- 1 Juden in Hamburg
- 2 Die Geschichte der Sepharden im Hamburger Raum
- 2.2 Juden aus Hamburg ziehen in die neuen Kolonien und bauen Handelswege auf
- 2.3 Neue Reglements machen das kleine Städtchen Altona für die Sepharden attraktiv
- 2.4 Sabbatianismus und weitere innerjüdische Probleme der sephardischen Gemeinde
- 2.5 Die Bedeutung der Sepharden für die Untersuchungsfrage
- 3 Die Geschichte der Aschkenasim im Hamburger Raum
- Die frühesten Ansiedlungen von Aschkenasim im Hamburger Raum sind durch die Quellen nicht belegt
- 3.1.1 Erste belegte Ansiedlung in Altona und der Zuzug weiterer Juden aufgrund großzügiger Privilegien
- 3.1.2 Die kleine jüdische Gemeinde in Harburg
- 3.1.3 Wandsbek als erster Ort der jüdischen Ansiedlung mit rasantem Abstieg
- 3.1.4 Der Grund aller Ansiedlungen im Hamburg Raum: Die Freie- und Hansestadt Hamburg
- 3.2 Der Altonaer Friedhofstreit führt zur Gründung der Dreigemeinde
- 3.3 Der Hamburger Amulettenstreit und seine beiden Protagonisten Jonathan Eybenschütz und Jakob Emden
- 3.4 Die letzte Phase der Dreigemeinde und ein kurzer biografischer Abriss der letzten Oberrabbiner
- 4 Hamburg in der Franzosenzeit (1806-1814)
- 4.1 Frankreich seit dem Staatsstreich Napoleons und Hamburgs Wirtschaftsboom zu dieser Zeit
- 4.2 Die erste Besetzung Hamburgs zur Durchsetzung der Kontinentalsperre und ihre Folgen
- 4.3 Das Zwischenspiel der Befreiung
- 4.4 Frankreichs Niederlage, der Rückzug in die Stadt und die sich anschließende Belagerung sorgen für Elend bei der Bevölkerung
- 4.5 Die Befreiung Hamburgs
- 4.6 Welche Auswirkungen hatte die Franzosenzeit für die Juden?
- 5 Napoleons Judengesetzgebung
- 5.1 Der jüdische Kampf um das Bürgerrecht und die Assimilationsbestrebungen der Haskalah
- 5.2 Die Judenfrage wird zur Staatsangelegenheit
- 5.3.1 Die Einberufung einer jüdischen Notabelnversammlung
- 5.3.2 Die Auswahl der Notabeln
- 5.3.3 Die Notabelnversammlung
- 5.4 Vorbereitungen zum Sanhedrin
- 5.5 Das Sanhedrin
- 5.6 Vom Abschluss der Versammlungen bis zu den Kaiserlichen Dekreten Napoleons vom 17. März 1808
- 5.7 Die Wirkung der Dekrete für die Juden in Frankreich
- 6 Die Aufteilung der Dreigemeinde
- 7 Untersuchungsergebnis
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Links