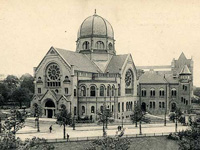
Die Aufteilung der jüdischen Dreigemeinde in Hamburg 1812von Simon Hollendung
|
2 Die Geschichte der Sepharden im Hamburger Raum
2.1 Die Ankunft der ersten portugiesischen Judennach den Pogromen der spanischen Reconquista 1492
Anders als in südlicheren Städten des späteren Deutschlands, vor allem am Rhein, sind Ansiedlungen von Juden in Hamburg und Umgebung erst ab 1590 bekannt[15]. Im Jahr der Amerika-Entdeckung durch Kolumbus 1492 nahm die Verfolgung der Juden durch seinen Auftraggeber, die spanische Krone, in der Reconquista massiv zu. Wenige Jahre später kam es auch in Portugal zu Zwangstaufen, denen ab 1506 Pogrome folgten. Den zwangskonvertierten iberischen Juden, Sephardim[16] genannt, blieben nur kleine Zeitfenster zur Auswanderung. Diese fand dann bevorzugt in Länder statt, die neben persönlicher Sicherheit auch Chancen für kaufmännisches Unternehmertum boten: Südfrankreich, Italien, die Niederlande und ab 1590 auch Hamburg.[17]
Bereits vorher waren Kaufleute aus den Niederlanden und Frankreich in Hamburg ansässig, so dass die Angehörigen der portugiesischen Nation, wie es offiziell hieß, als reiche Katholiken aufgenommen wurden. 1601 erlaubten Spanien und Portugal kurzzeitig die Ausreise der Zwangskonvertiten, was auch die Gemeinde in Hamburg rapide ansteigen ließ.
Obwohl offiziell als Katholiken geführt, findet sich bereits 1603 die erste Erwähnung von Juden in Hamburg. Ihre Anzahl stieg gemäß den Senatslisten auf 100 portugiesische Kaufleute und ihre Familien im Jahre 1610 und auf 125 im Jahre 1625.[18]
Dies führte zum Unmut und dem Ruf nach Ausweisung durch einige bürgerlich-christliche Kreise, angestachelt von hetzerischen Pastoren. Dem Senat war allerdings der Handel mit der iberischen Halbinseln, der zu großen Teilen über die Beziehungen einiger Sephardim lief, wichtiger und so beließ er es bei Schutzgeldzahlungen, dem Verbot, bestimmte Berufe und die jüdische Religion auszuüben sowie der Forderung nach redlichem und unauffälligem Verhalten.[19]
Ein Vertrag von 1612 manifestierte diese Vorgaben sehr viel früher als bei den Aschkenasim und erlaubte als einziges religiöses Zugeständnis die Beerdigung der Toten am Heuberg, heute Königsstraße, außerhalb der Stadt. Dort, im seit der Reformation wesentlich liberaleren Altona, hatten die Sephardim am 31. Mai 1611 ein Stück Land vom Grafen Ernst III. von Holstein-Schaumburg erworben.[20]
Neue Auflagen des Senats von 1617 brachten den Sephardim sowohl die Verdoppelung der Abgaben wie auch etwas mehr Freiraum im Religions- und Erwerbsleben (Articuli worauf die Handlung mit dero allhier residirenden Nation beschlossen wurde, vom 8. Dezember 1617[21]). Das Synagogenverbot blieb aus Angst vor Aufruhr unter der Bevölkerung erhalten. Es wurde allerdings umgangen, in dem Betstuben erst geduldet und dann erlaubt wurden. Als neue Zuwanderungen den Handel in der Hansestadt deutlich verbesserten, stellte der Senat 1623 Pöbeln gegen Juden unter Strafe (Contract, vom 30. Oktober 1623[22]). Ab 1640 kommen erneut viele Portugiesen nach Hamburg, weil ihr nun eigenständiges Heimatland mit der Unabhängigkeit verschärft gegen die Sephardim vorging.[23]
[15] Die erste Datierung jüdischen Lebens in Hamburg wird mittlerweile vereinheitlicht mit diesem Jahr angegeben (vgl. den Titel des Sammelbandes: Die Juden in Hamburg 1590 – 1990, hrsg. v. Arno Herzig, Hamburg 1991).
Böhm kann das Jahr 1577 der älteren Literatur als irrtümliche Auslegung entlarven (Böhm 1991, S. 21), abweichend von 1590 als historischem Konsens gibt Marwedel (ohne Bezug oder Beleg) „um 1575“ (Marwedel 1982, S. 16) als Beginn der jüdischen Geschichte in Hamburg an, Geiss in seinem Nachschlagewerk erst 1612 als Ankunft der ersten Sepharden (Geiss 2002, S. 438)..
[16] Sephardim: Mit dem hebräischen Wort "Sephar" wird der Wohnsitz der Nachkommen Sems in der Bibel bezeichnet. Dieser wird mit der iberischen Halbinsel identifiziert und als "Sephardim" die Juden (und Zwangskonvertiten) bezeichnet, die dort lebten. Die Sephardim sind einer der drei großen Teilzweige des Judentums, haben im Spaniolischen ihre eigene Sprache und bezeichnen nicht, wie oft falsch dargestellt, orientalische Juden.
Vgl.: Geiss, Immanuel: Geschichte griffbereit, Bd. 4: Begriffe, München, Gütersloh 2002, S. 438.
[17] Vgl.: Böhm, Günter: Die Sephardim in Hamburg, in: Die Juden in Hamburg 1590-1990. Wiss. Beiträge der Uni Hamburg zur Ausstellung Vierhundert Jahre Juden in Hamburg, hrsg. v. Arno Herzig, Hamburg 1991. S. 21 - 40. Hier: S. 21.
[18] Vgl. Graupe (1973), S. 11.
[19] Vgl.: Böhm, S. 23.
[20] Vgl.: Böhm, S. 23 und Freimark, Peter: Jüdische Friedhöfe im Hamburger Raum, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburger Geschichte Nr. 67, Hamburg 1981. S. 118 – 120. Hier: 118.
Nach Freimark ist dieser Friedhof bereits 1611 in Betrieb genommen worden, sein Beitrag ist neu abgedruckt in: Lorenz, Ina (Hrsg.): Zerstörte Geschichte. 400 Jahre jüdisches Leben in Hamburg, Hamburg 2005.
[21] In: Reils (1847), S. 381-387.
[22] In: Reils (1847), S. 389-393.
[23] Nach Böhm (1991), S. 22ff.
Inhalt
- 1 Juden in Hamburg
- 2 Die Geschichte der Sepharden im Hamburger Raum
- 2.2 Juden aus Hamburg ziehen in die neuen Kolonien und bauen Handelswege auf
- 2.3 Neue Reglements machen das kleine Städtchen Altona für die Sepharden attraktiv
- 2.4 Sabbatianismus und weitere innerjüdische Probleme der sephardischen Gemeinde
- 2.5 Die Bedeutung der Sepharden für die Untersuchungsfrage
- 3 Die Geschichte der Aschkenasim im Hamburger Raum
- Die frühesten Ansiedlungen von Aschkenasim im Hamburger Raum sind durch die Quellen nicht belegt
- 3.1.1 Erste belegte Ansiedlung in Altona und der Zuzug weiterer Juden aufgrund großzügiger Privilegien
- 3.1.2 Die kleine jüdische Gemeinde in Harburg
- 3.1.3 Wandsbek als erster Ort der jüdischen Ansiedlung mit rasantem Abstieg
- 3.1.4 Der Grund aller Ansiedlungen im Hamburg Raum: Die Freie- und Hansestadt Hamburg
- 3.2 Der Altonaer Friedhofstreit führt zur Gründung der Dreigemeinde
- 3.3 Der Hamburger Amulettenstreit und seine beiden Protagonisten Jonathan Eybenschütz und Jakob Emden
- 3.4 Die letzte Phase der Dreigemeinde und ein kurzer biografischer Abriss der letzten Oberrabbiner
- 4 Hamburg in der Franzosenzeit (1806-1814)
- 4.1 Frankreich seit dem Staatsstreich Napoleons und Hamburgs Wirtschaftsboom zu dieser Zeit
- 4.2 Die erste Besetzung Hamburgs zur Durchsetzung der Kontinentalsperre und ihre Folgen
- 4.3 Das Zwischenspiel der Befreiung
- 4.4 Frankreichs Niederlage, der Rückzug in die Stadt und die sich anschließende Belagerung sorgen für Elend bei der Bevölkerung
- 4.5 Die Befreiung Hamburgs
- 4.6 Welche Auswirkungen hatte die Franzosenzeit für die Juden?
- 5 Napoleons Judengesetzgebung
- 5.1 Der jüdische Kampf um das Bürgerrecht und die Assimilationsbestrebungen der Haskalah
- 5.2 Die Judenfrage wird zur Staatsangelegenheit
- 5.3.1 Die Einberufung einer jüdischen Notabelnversammlung
- 5.3.2 Die Auswahl der Notabeln
- 5.3.3 Die Notabelnversammlung
- 5.4 Vorbereitungen zum Sanhedrin
- 5.5 Das Sanhedrin
- 5.6 Vom Abschluss der Versammlungen bis zu den Kaiserlichen Dekreten Napoleons vom 17. März 1808
- 5.7 Die Wirkung der Dekrete für die Juden in Frankreich
- 6 Die Aufteilung der Dreigemeinde
- 7 Untersuchungsergebnis
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Links