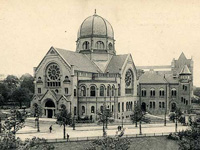
Die Aufteilung der jüdischen Dreigemeinde in Hamburg 1812von Simon Hollendung
|
3.1.1 Erste belegte Ansiedlung in Altona und der Zuzug weiterer Juden aufgrund großzügiger Privilegien
Das älteste erhaltene Privileg für die Niederlassung von Juden im Hamburger Raum stammt aus dem Jahre 1584 und wurde von Graf Adolf für die Dörfer Altona und Ottensen ausgestellt. Dieses Privileg beinhaltete Religionsfreiheit, die Möglichkeit, ehrbaren Berufen nachzugehen sowie Zins- Wechsel- und Pfandbestimmungen für vier namentlich genannte Juden und einen Schulmeister plus den jeweiligen Familien (Geleitbrief des Grafen Adolf XII. von Holstein-Schauenburg, vom 28. September 1584[37]).
Die Niederlassung beinhaltet wohl noch nicht die Gründung einer Gemeinde, da diese erst für 1612 belegt ist, allerdings könnten die fünf Haushalte bereits in der Lage gewesen sein, die für einen Gottesdienst benötigten zehn jüdischen Männer über 13 Jahre zu stellen.
1602 wurde in Altona eine Münzstätte eröffnet, für die wahrscheinlich Juden als Silbereinkäufer und den Umlauf der Münzen angestellt wurden. 1612 schloss die Münzstätte und zugleich findet ein allgemeines Privilegium des Grafen Ernst III. von Holstein-Schauenburg für die Altonaer Juden vom 5. Mai 1612[38]. Dieses Privileg beinhaltet keine Angabe von Namen und Zahlen und scheint daher für eine größere Gruppe von Juden, ohne ihre Anzahl begrenzen zu wollen, gedacht. Daher ist das Jahr 1612 als erste Gemeindegründung im Hamburger sehr wahrscheinlich, allerdings nicht erst als erste Ansiedlung von Juden, wie Geiss fälschlicherweise datiert.[39]
Bereits 1614 erschien ein Geleitbrief für die Altonaer Juden[40], in denen von 16 Familien (ohne Namensnennung) die Rede war. Ein Grabstein gab dem am 18. August 1621 gestorbenen Schmu´el ben J´huda die Bezeichnung Gemeinde-gründer[41].
Ebenfalls 1614 baten drei Hamburger Juden darum, einen Rechtsstreit in Altona vorzubringen. Graupe folgert daraus: „In Altona müssen also bereits zu dieser Zeit gelehrte Kenner des jüdischen Rechts gewohnt haben.“[42] Dadurch, dass Hamburger Juden sich an die Altonaer Jurisdiktion wendeten, scheint eine Art rabbinische Vormachtsstellung Altonas sich bereits hier zaghaft abzuzeichnen.
Eine Urkunde von 1619 weist durch die Nennung von Ältesten und Vornehmsten der Gemeinde bereits einen Vorstand aus.
Auf den 21. Mai 1622 datiert ein Privilegium für 30 Familien in Altona, ohne Namensnennung[43]. Ein weiterer, undatierter Schutzbrief (wohl ca. 1620) zeigt bereits die typische Wohnortsverteilung der späteren Jahre. Von den 17 genannten Schauenburger Schutzjuden wohnten acht in Altona und neun in Hamburg (vier weitere werden genannt, die von Hamburg nach Altona wollten).
Dieses älteste Zeugnis für Juden in Hamburg zeigt, dass bereits mehr Juden den Schutz der Schauenburger Grafen suchen, als in Altona wohnhaft sind. Der „wohlhabende Teil der Altonaer Gemeinde lebte in Hamburg, der großen Handels- und Hafenstadt mit ihren wirtschaftlichen Möglichkeiten.“[44] Oft wird in den jüdischen und vor allem altonaischen Quellen dieser Zeit bereits von den Statuten der Gemeinde Altona und Hamburg gesprochen, was sich erst ein halbes Jahrhundert später faktisch durch die Konföderation umsetzen ließ.
Zum Gedeihen der Altonaer Schutzjudenschaft gehörten aber die für den gesamten Hamburger Raum liberalsten Bestimmungen und Auflagen durch die Schauenburger Grafen, in deren Schatten sich aber auch eine starke Gemeindeautonomie unter einem konservativen Rabbinat entwickelte.
Im Jahre 1640 besetzte Dänemark nach dem Tod von Graf Otto von Schaumburg die Herrschaft Pinneberg und der dänische König Christian IV. erließ im August 1641 ein neues, erweitertes Privileg. Gemäß Graupe handelte es sich um eine der größten Gemeindeautonomien, die den Juden im gesamten Römischen Reich deutscher Nationen zugestanden wurde[45] (Generalprivileg Christian IV. für die hochdeutschen Juden in Altona, vom 1. August 1641[46]).
Neben dem dadurch ermöglichten politischem Zugang zur Deutschen Kanzlei und zum Königlichen Hof in Kopenhagen wurde die Jurisdiktion des Altonaer Rabbiners auf alle Zivil- und Zeremonial- und Gemeindeangelegenheiten im Gebiet der noch nicht vereinigten drei Gemeinden und darüber hinaus bis zum kleinen Belt ausgeweitet. Die Jurisdiktion beinhaltet zwar nicht die sephardischen Gemeinden wie die in Glückstadt und musste in wichtigen Angelegenheiten gemeinsam mit dem Altonaer Gemeindevorstand erfolgen, sie beinhaltet aber das flächen- und zahlenmäßig größte Gebiet einer einheitlichen jüdischen Rechtsprechung in Europa und gab dem Altonaer Rabbi eine ungewöhnliche Machtfülle.
„Die Einbeziehung der Juden in Hamburg in die Altonaer Jurisdiktion weckte den Widerspruch der Hamburger Behörden und wurde zu einem Streitpunkt, der auch für den Antagonismus von Dänemark und Hamburg politisch bedeutsam wurde.“[47]
Der Konflikt zwischen Hamburg und Dänemark wurde auch auf dem Rücken der jüdischen Gemeinde(n) ausgetragen und verschärfte sich bei der Gründung der Dreigemeinde noch einmal erheblich. In dem beschriebenen Antagonismus müssen auch die Gründe für das Verhalten der Hamburger Behörden in und vor allem nach der Franzosenzeit gesucht werden.
Die Situation der Altonaer Juden änderte sich nach dem Tode von Christian IV. von Dänemark nur marginal: Die alten Verträge wurden konfirmiert, mit weiteren Zusätzen und Einschränkungen versehen, die Selbstverwaltung der Gemeinde konnte ausgebaut werden[48] und am 23. April 1669 wurde das Verhältnis zu den Sepharden vertraglich[49] festgeschrieben.
Die Altonaer Schutzjuden bekamen für ihre Schutzgeldzahlung Wohnrecht, Schutz durch den Landesherrn sowie bestimmte Rechte zur Religions- und Erwerbstätigkeit. Trotz weiterer Steuern und Kirchengeld sowie erheblichen Belastungen durch Krieg, Pest und Brandschaden wuchs die Gemeinde in Altona.
Dies lag an dem im Vergleich zu Preußen niedrigem Schutzgeld ebenso wie an den guten Rahmenbedingungen für Eigenständigkeit und Wirtschaftstätigkeit: Es gab keine Obergrenze für aschkenasischen Zuzug; Grunderwerb war weder Bedingung noch Verbot; die Einschränkungen in der Erwerbstätigkeit vergleichsweise akzeptabel; Gemeindeautonomie und Religionsfreiheit wurden ebenso wie der Schutz vor Übergriffen konsequent durchgesetzt.
Vor allem die Nähe zu Hamburg bei gleichzeitiger Fluchtmöglichkeit auf die Dörfer und unter dänischen Schutz war wichtig. Denn trotz scharfer Bestrafung durch den Senat drückte sich die permanente Judenfeindschaft mehrmals in Übergriffen aus.
[38] In: Marwedel (1976), S. 115ff.
[39] Geiss (2002), Bd. 4, S. 438.
[40] In: Marwedel (1976), S. 120f.
[41] Vgl. Graupe (1973), S. 15.
[42] Ebd.
[43] In: Marwedel (1973), S.131ff.
[44] Graupe, S. 16.
[45] Vgl. Graupe (1973), S. 18.
[46] In: Marwedel (1976), S. 134ff.
[47] Graupe (1973), S. 18.
[48] Vgl. die verschiedenen Konfirmationen der alten Privilegien in: Marwedel (1976), S. 150-170.
[49] StaAHH Bestand Jüdische Gemeinden 1, Bl. 39 a – 40.
Inhalt
- 1 Juden in Hamburg
- 2 Die Geschichte der Sepharden im Hamburger Raum
- 2.2 Juden aus Hamburg ziehen in die neuen Kolonien und bauen Handelswege auf
- 2.3 Neue Reglements machen das kleine Städtchen Altona für die Sepharden attraktiv
- 2.4 Sabbatianismus und weitere innerjüdische Probleme der sephardischen Gemeinde
- 2.5 Die Bedeutung der Sepharden für die Untersuchungsfrage
- 3 Die Geschichte der Aschkenasim im Hamburger Raum
- Die frühesten Ansiedlungen von Aschkenasim im Hamburger Raum sind durch die Quellen nicht belegt
- 3.1.1 Erste belegte Ansiedlung in Altona und der Zuzug weiterer Juden aufgrund großzügiger Privilegien
- 3.1.2 Die kleine jüdische Gemeinde in Harburg
- 3.1.3 Wandsbek als erster Ort der jüdischen Ansiedlung mit rasantem Abstieg
- 3.1.4 Der Grund aller Ansiedlungen im Hamburg Raum: Die Freie- und Hansestadt Hamburg
- 3.2 Der Altonaer Friedhofstreit führt zur Gründung der Dreigemeinde
- 3.3 Der Hamburger Amulettenstreit und seine beiden Protagonisten Jonathan Eybenschütz und Jakob Emden
- 3.4 Die letzte Phase der Dreigemeinde und ein kurzer biografischer Abriss der letzten Oberrabbiner
- 4 Hamburg in der Franzosenzeit (1806-1814)
- 4.1 Frankreich seit dem Staatsstreich Napoleons und Hamburgs Wirtschaftsboom zu dieser Zeit
- 4.2 Die erste Besetzung Hamburgs zur Durchsetzung der Kontinentalsperre und ihre Folgen
- 4.3 Das Zwischenspiel der Befreiung
- 4.4 Frankreichs Niederlage, der Rückzug in die Stadt und die sich anschließende Belagerung sorgen für Elend bei der Bevölkerung
- 4.5 Die Befreiung Hamburgs
- 4.6 Welche Auswirkungen hatte die Franzosenzeit für die Juden?
- 5 Napoleons Judengesetzgebung
- 5.1 Der jüdische Kampf um das Bürgerrecht und die Assimilationsbestrebungen der Haskalah
- 5.2 Die Judenfrage wird zur Staatsangelegenheit
- 5.3.1 Die Einberufung einer jüdischen Notabelnversammlung
- 5.3.2 Die Auswahl der Notabeln
- 5.3.3 Die Notabelnversammlung
- 5.4 Vorbereitungen zum Sanhedrin
- 5.5 Das Sanhedrin
- 5.6 Vom Abschluss der Versammlungen bis zu den Kaiserlichen Dekreten Napoleons vom 17. März 1808
- 5.7 Die Wirkung der Dekrete für die Juden in Frankreich
- 6 Die Aufteilung der Dreigemeinde
- 7 Untersuchungsergebnis
- Quellen- und Literaturverzeichnis
- Links